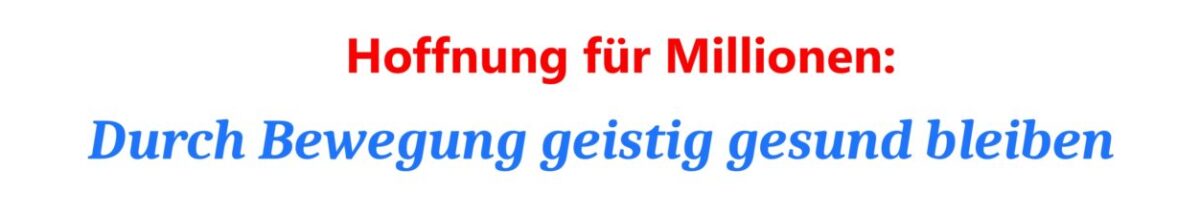Von der Vorstufe Demenz gibt’s auch ein Zurück
Wenn Vergesslichkeit zur Warnung wird
Millionen Menschen in der Vorstufe einer Demenz – dem sogenannten Mild Cognitive Impairment (MCI) – fühlen sich alleingelassen. Die ersten Anzeichen schleichen sich meist unbemerkt ein: Vergesslichkeit, Schwindel, nachlassende Beweglichkeit. Oft werden sie als harmlose Alterserscheinungen abgetan. Doch wer die Warnsignale ignoriert oder sich mit pauschalen Ratschlägen wie „gesund leben“ oder „mehr bewegen“ zufriedengibt, verpasst womöglich die letzte Chance, den Weg in die Demenz zu stoppen.
Dabei gibt es einen Weg zurück – beschwerlich, aber lohnend. Er führt nicht über Medikamente, sondern über gezielte, koordinativ anspruchsvolle Aktivitäten, mit denen sich das Gehirn regenerieren kann. Diese Ausarbeitung zeigt, warum herkömmliche Empfehlungen wie einfaches Ausdauertraining zu kurz greifen – und wie Betroffene durch vielseitige Bewegung ihre geistige Leistungsfähigkeit neu beleben können.
Widerspruch zu den Empfehlungen der WHO
Regelmäßige Bewegung gilt als Schlüssel zu körperlicher und geistiger Gesundheit. Gerade im Alter raten Gesundheitsbehörden und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu regelmäßigem, moderatem Ausdauertraining. Doch an dieser Empfehlung gibt es Widerspruch.
Der Neurologe Prof. Dr. Peter Rieckmann und der sportlich engagierte Ruheständler Ulrich Scheuerl argumentieren: So einfach ist es nicht. Wenn das Gehirn bereits geschädigt ist und erste kognitive Einbußen auftreten, reicht ein dreistündiges Ausdauertraining pro Woche nicht aus – es ist zu wenig und zu einseitig. Um zu verstehen, warum das so ist, haben sie die Wirkung der fünf Bewegungsarten untersucht – von Ausdauer über Kraft bis hin zu koordinativ komplexen Aktivitäten.
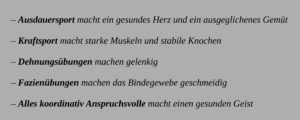
Was macht eine Aktivität „koordinativ anspruchsvoll“?
Bewegung erfordert immer Koordination – doch nicht jede fordert das Gehirn gleichermaßen. Während routinierte Abläufe wie Dehnen, Krafttraining oder Gehen kaum geistige Anstrengung verlangen, wird das Gehirn bei komplexen, unvorhersehbaren Bewegungen stark gefordert. Entscheidend sind Neuigkeitsgrad und Komplexität.
- Geringe Herausforderung: vorhersehbare, monotone Abläufe wie Spazierengehen oder Training an Geräten – das Gehirn läuft auf „Autopilot“.
- Hohe Herausforderung: Bewegungen, die Gleichgewicht, Timing, räumliche Orientierung und Feinmotorik gleichzeitig verlangen.
Beispiele:
Selbst Backen fordert Konzentration, Präzision und Kreativität – vom Abmessen bis zum kunstvollen Verzieren. Beim Tanzen müssen Schrittfolgen, Rhythmus und Partnerbewegungen koordiniert werden. Beim Tischtennis berechnet das Gehirn fortlaufend Ballflug, Schlägerführung und Körperposition. Beim Jonglieren werden Augen-Hand-Koordination und Reaktionsvermögen trainiert. Wandern im unwegsamen Gelände stärkt Gleichgewicht und Balance.
Warum solche Aktivitäten so wertvoll sind
Das Gehirn ist wie ein Muskel: Es wächst nur, wenn es gefordert wird. Bei Kindern ist das offensichtlich – beim Laufenlernen entstehen neue neuronale Verbindungen. Doch auch im Alter lässt sich das Gehirn neu vernetzen, solange es mit ungewohnten Aufgaben konfrontiert wird.
Sobald eine Bewegung zur Routine wird, lässt der Trainingseffekt nach. Der Schlüssel liegt also im ständigen Neulernen: Ob man als Senior*in erstmals jongliert oder nach Jahrzehnten wieder Tischtennis spielt – jedes neue Bewegungsmuster wirkt wie ein Update für das Gehirn.
Was die Forschung zeigt – und was noch fehlt
Bewegung als Schutz vor Demenz ist gut untersucht. Es gibt zwei Hauptlinien der Forschung:
- Ausdauerstudien, etwa die bekannte FINGER-Studie.
- Einzelstudien zu spezifischen Aktivitäten wie Tanzen, Yoga, Tischtennis, Jonglieren oder Klavierspielen.
Alle zeigen positive Effekte – doch jede Aktivität allein kann Alzheimer nur geringfügig verzögern. Was fehlt, sind Langzeitstudien, die das Zusammenwirken mehrerer koordinativ anspruchsvoller Aktivitäten untersuchen. Eine solche gibt es bisher weltweit nicht.
Was es braucht, ist eine Studie mit Teilnehmern, die sich verpflichten, regelmäßig und vielseitig anspruchsvoll aktiv zu sein – ein echtes „Zehnkampfprogramm gegen Demenz“.
Ist Demenzvermeidung ein Zehnkampf?
Für Ulrich Scheuerl waren die bisherigen Studienergebnisse unbefriedigend – besonders angesichts der stetig steigenden Demenzzahlen. Gemeinsam mit Prof. Dr. Rieckmann kam er zu der Überzeugung: Statt nur die Ausdauer zu trainieren, muss man vielseitig aktiv werden – nicht eine, nicht zwei, sondern möglichst viele unterschiedliche koordinative Aktivitäten regelmäßig ausüben.
Millionen von der Vorstufe Demenz (MCI) betroffen!
Alzheimer entwickelt sich in drei fließenden Phasen. Auf ein jahrzehntelang ungesundes Leben folgt die Vorstufe MCI, bevor die Krankheit in die unumkehrbare Demenz übergeht. Doch der Weg ist nicht zwangsläufig vorgezeichnet. Von MCI kann man zurückkehren – zu einem Leben mit geistiger Klarheit. Voraussetzung: Man erkennt die Warnzeichen und nutzt gezielt die Chancen der Neuroplastizität, der Anpassungsfähigkeit des Gehirns.

MCI (Mild Cognitive Impairment) ist der Fachbegriff für „leichte kognitive Störungen“ und meint nichts anderes als erste Anzeichen von Demenz. Ursache dafür ist ein Jahrzehnte lang sorglos geführtes Leben und typische Anzeichen sind Orientierungsstörungen, häufige Schwindelgefühle, verminderte Beweglichkeit, Vergesslichkeit oder Wortfindungsstörungen.
Wer sich zeitlebens gesund ernährt, Stress vermieden und sich ausreichend bewegt hat, den braucht das Thema Alzheimer erst einmal nicht zu bekümmern. Viele können das aber nicht von sich sagen. Und die Hälfte derer, die im Alter von beginnender Demenz betroffen sind, wird sich, wie die Statistik zeigt, in den Folgejahren in Betreuung begeben müssen. Dass sich die Gesellschaft und erst recht die alten Menschen heute damit abfinden, sollte nicht sein, denn wenn sich die Vorzeichen zeigen, kann man durchaus noch etwas machen. Etwas machen, das heißt die Möglichkeiten zu nutzen, was Neurologen mit dem wissenschaftlichen Ausdruck „Neuroplastizität“ bezeichnen.
Neuroplastizität – das formbare Gehirn
Unter Neuroplastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, sich strukturell und funktionell zu verändern – ein Leben lang. Das neuronale Netzwerk passt sich neuen Anforderungen an.
Dabei unterscheiden Forscher zwei Formen: Sportinduzierte Neuroplastizität – sie wird bewusst durch gezielte, komplexe Bewegung aktiviert und kann gezielt zur Demenzprävention eingesetzt werden. Alltägliche Neuroplastizität – sie geschieht unbewusst durch neue Erfahrungen und Lernprozesse.
Viele bewegen sich – aber zu einseitig
Viele ältere Menschen sind durchaus aktiv, jedoch meist monoton: Die einen radeln zehntausende Kilometer, andere laufen täglich oder schwimmen regelmäßig. Doch das Gehirn braucht Vielseitigkeit, um all seine Netzwerke zu erhalten. Nur wenn verschiedene Bewegungsarten regelmäßig trainiert werden, bleiben die neuronalen Schaltkreise in allen Regionen funktionsfähig.
Man spürt den Unterschied
Ob Bewegung Alzheimer tatsächlich verhindern kann, ist wissenschaftlich noch nicht belegt – doch sie macht sich bemerkbar. Wer Fortschritte spürt, wer Bewegungen von mal zu mal leichter und präziser ausführt, der aktiviert genau jene Netzwerke, die das Gehirn gesund halten.
Und gelingt das bei vielen unterschiedlichen Aktivitäten, darf man mit gutem Recht sagen: Meine neuronalen Netze sind intakt – mein Gehirn ist gesund.
Nachfolgend wird in sechs Abschnitten mit 70 Beiträgen und vielen Bildern anschaulich gemacht, dass geistige Fitness im Alter möglich ist. Motivation stets vorausgesetzt.